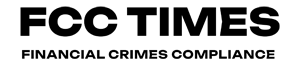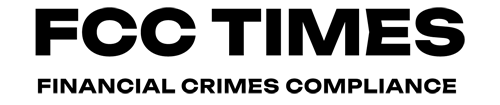Osteuropa und Zentralasien
Der anhaltende russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beherrschte weiterhin die Situation in der Region und ging mit zahlreichen völkerrechtlichen Verstößen einher. In zahlreichen Ländern befanden sich die Menschenrechte auf Talfahrt. Im Zuge des Kriegs und zunehmender autoritärer Praktiken ignorierten immer mehr Länder ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen, höhlten entsprechende nationale und internationale Institutionen aus und übten gleichzeitig Druck auf jene aus, die mutig für die Menschenrechte eintraten.
Russlands unablässige Verstöße gegen das Völkerrecht und das humanitäre Völkerrecht, zum Beispiel durch gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur, führten zu unzähligen Todesopfern und einer dramatischen Verschlechterung der Lebensbedingungen in der Ukraine, unter der Kinder und andere gefährdete Gruppen besonders stark litten.
Diese Verbrechen blieben ebenso straflos wie Verstöße, die im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan verübt wurden. Zahlreiche weitere Regierungen in Osteuropa und Zentralasien, die dreiste Angriffe auf die Menschenrechte unternahmen, mussten ebenfalls keine Konsequenzen befürchten. Zivilgesellschaftliche Gruppen waren gezielten Angriffen ausgesetzt und konnten in vielen Ländern gar nicht mehr tätig sein oder nur noch unter riskanten Bedingungen bzw. heimlich. Menschenrechtsverteidiger*innen wurden in vielen Ländern inhaftiert oder waren gezwungen, ins Exil zu gehen. In einigen Fällen trotzten friedliche Protestierende der zunehmenden Repression, obwohl sie beispiellose Gewalt befürchten mussten. Der mutige Einsatz zahlreicher Menschen konnte jedoch nicht verhindern, dass die Menschenrechte immer stärker in die Defensive gerieten.
Viele Regierungen missbrauchten Gesetze gegen Extremismus und Terrorismus, um kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen, und führten “traditionelle Werte” ins Feld, um gegen lesbische, schwule, bisexuelle, trans und intergeschlechtliche Menschen (LGBTI+) vorzugehen und sexuelle und reproduktive Rechte zu beschneiden. Internationale Organisationen und andere Akteur*innen hatten zunehmend weniger Möglichkeiten, die Menschenrechtslage vor Ort zu beobachten. Immer häufiger wurden Aktivist*innen, die ins Exil gegangen waren, auch im Ausland verfolgt, was deutlich machte, dass die nationalen und internationalen Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte bei Weitem nicht ausreichten.
In Osteuropa und Zentralasien gab es 2024 Rückschläge bezüglich des Rechts auf Religions- und Glaubensfreiheit. Die Justiz wurde ganz unverhohlen für die Unterdrückung abweichender Meinungen instrumentalisiert, und Folter und andere Misshandlungen waren weiterhin an der Tagesordnung. Geschlechtsspezifische Gewalt nahm zu, und die Rechte von Flüchtlingen und Migrant*innen wurden noch stärker ausgehöhlt.
Die Förderung und der Verbrauch fossiler Brennstoffe nahmen insgesamt zu. Die daraus resultierende Luftverschmutzung führte in vielen Ländern zu Gesundheitsschäden.